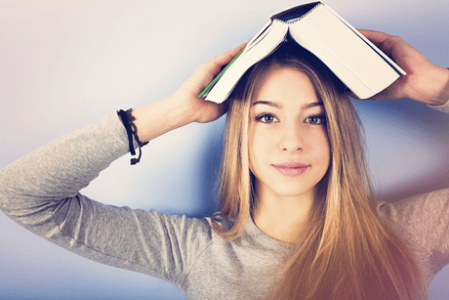So kommen Hoch- und Tiefdruckgebiete zu ihren Namen

Wetterphänomene werden oftmals nach den Hoch- und Tiefdruckgebieten benannt, die sie verursachen. Wir erklären, wer diese Namen vergibt, wie man selber Pate werden kann und was Hoch- und Tiefdruckgebiete eigentlich sind!
Hochdruckgebiete sorgen für klaren Himmel und schönes Wetter, Tiefdruckgebiete im Gegenteil für Wolken, Regen und Schnee. Auch auf unseren Körper kann der Luftdruck Auswirkungen haben. Ebenso bleiben Namen verheerender Stürme in Erinnerung.
So können Sie dem Wetter einen Namen geben
Über die Namensgebung entscheidet das Meteorologische Institut der Freien Universität Berlin. Seit 1954 kann man über ein Antragsformular selber Wetterpate werden und Tief- oder Hochdruckgebiet. nach sich selbst oder einem anderen Wunschnamen benennen lassen. In geraden Jahren sind die Hochdruckgebiet. männlich und die Tiefdruckgebiete weiblich, 2019 sind folglich die Hochs weiblich während die Tiefs männliche Namen erhalten.
Was sind eigentlich Hochdruck und Tiefdruck?
Sinken Luftmassen stark ab, steigt der Druck am Boden und man spricht von einem Hochdruckgebiet. Meteorologen unterscheiden das dynamische Hoch, das Kältehoch und das Höhenhoch oder thermische Hoch. Im dynamischen Hochdruckgebiet lagern sich Kaltluftmassen in den unteren Luftschichten ab, auch bei einem Kältehoch wird die Luft kühl und übt dadurch größeren Druck auf den Boden aus, wetterfühlige Menschen leiden dann an Kopfschmerzen. Das Höhenhoch beschreibt ein Hochdruckgebiet ab einer Entfernung von ca. 5 km von der Erdoberfläche. Zeitgleich entsteht ein Bodentief, doch die Luftmassen in diesem thermischen Hochdruckgebiet sinken ab und bringen den Luftdruck am Boden zum Steigen. Jetzt kann es sehr windig werden.
Wie wird das Wetter bei mir? freenet Wetter verrät es>>
Während des Absinkens wird die Luft erwärmt, durch Inversion lösen sich die Wolken auf und der Himmel ist klar. Normalerweise führt dies zu schönem Wetter, denn die Sonne kann ungehindert scheinen. Durch die Corioliskraft kann es jedoch zu starkem Wind kommen. Diese Kraft lenkt eine sich bewegende Luftmasse auf der Nordhalbkugel in Bewegungsrichtung nach rechts, auf der Südhalbkugel entsprechend nach links.
Das steckt hinter "Kopfwehwetter"
Der Luftdruck am Boden sinkt hingegen, wenn warme Luft nach oben steigt. Auf diesem Weg kühlt die steigende Luft ab und nimmt Wasser auf, das sich in Wolken sammelt und dann als Regen oder Schnee wieder auf die Erdoberfläche trifft. Ein Höhentief, das wie das Höhenhoch in ca. 5 km Entfernung vom Boden liegt, sorgt zudem häufig für starke Niederschläge. Vor einem solchen Wetterumschwung kann es ebenfalls zu Kopfschmerzen kommen.
Auch bei den Tiefdruckgebieten wird zwischen Dynamik und Thermik unterschieden. Thermische Tiefdruckgebiete bilden sich durch Abkühlung und Erwärmung der Luft. Bereits regional können sich solche Tiefdruckgebiete über warmen Wasserflächen bilden: Die Luft steigt auf, kühlt dabei ab und es entstehen Zirkulationen wie der Land- und Seewind. Auch Berg- und Talwind entstehen auf diese Weise, ebenso wie Hurrikans und Taifune. In dynamischen Tiefdruckgebieten treffen sich Luftschichten am Boden, steigen auf und stoßen sich in der Höhe ab, es entstehen Zyklone.