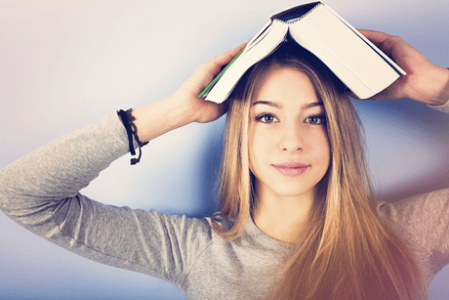+++ Besondere Brände erfordern besondere Maßnahmen +++ Feuerwehren der Samtgemeinde Elbtalaue trainieren die Brandbekämpfung von Vegetationsbränden +++

© Die Flammen schlugen bei der Ausbildung teils höher als einen Meter - durchaus ein realistisches Bild. (Kreisfeuerwehr/hbi)
Die Flammen schlugen bei der Ausbildung teils höher als einen Meter - durchaus ein realistisches Bild. (Kreisfeuerwehr/hbi)
Gusborn (hbi) Wald- und Vegetationsbrände sind besondere Brände.
Lüchow-Dannenberg (ots) - Sie unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen von Gebäudebränden und erfordern deshalb auch besondere Maßnahmen in der Brandbekämpfung. In Gusborn trainierten kürzlich fast 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Elbtalaue diese besonderen Maßnahmen. Mit dabei waren auch Kräfte der Waldbrandspezialeinheit "GFFF-V" und der Kreisfeuerwehrbereitschaft.
Der Tag begann am frühen Morgen im Feuerwehrhaus Gusborn. In der Einweisung in die zu bewältigenden Aufgaben betonten die erfahrenen Vegetationsbrand-Ausbilder noch einmal die Besonderheiten von Wald- und Flächenbränden.
Oberste Priorität habe es, sich selbst und die eingesetzten Fahrzeuge zu schützen. Steht ein Feuerwehrfahrzeug bspw. auf brennbarem Untergrund, kann das Feuer bei drehenden Winden schnell auf das Fahrzeug übergreifen und sowohl Gerät als auch die Einsatzkräfte gefährden. Daher ist es besonders wichtig, das Fahrzeug auf nicht brennbarem Untergrund abzustellen, wie bspw. einer Straße oder bereits verbrannter Fläche.
Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass bei einem Vegetationsbrand in unseren Breitengraden erfahrungsgemäß KEINE Menschenleben in Gefahr sind. Es geht also bei der Brandbekämpfung lediglich um Sachwerte und die Gefahr für die Umwelt. Aus diesen Gründen hat die eigentliche Brandbekämpfung gar nicht oberste Priorität. Ein Getreidefeld, was bereits in Brand steht, ist in der Regel sowieso "verloren" - entweder durch das Feuer oder durch das Löschwasser. Und beim Löschwasser liegt der nächste Schwerpunkt: Auf Feldern oder im Wald ist Wasser meist nicht unbegrenzt vorhanden, wie bspw. in einem Wohngebiet. Deshalb ist es ratsam, mit dieser Ressource sparsam umzugehen.
Aus den genannten Gründen sollte sich die Feuerwehr nicht darauf konzentrieren, in erster Linie das Feuer zu löschen. Vielmehr muss die Priorität darauf liegen, eine Brandausbreitung zu verhindern. Und da man sich nie einem Feuer in den Weg stellt, also das Feuer nicht von der Front aus bekämpft, legten die Ausbilder großen Wert darauf, dass im Erstangriff die sog. Flanken eingefangen werden. So wird das Feuer in seiner seitlichen Ausbreitung gehindert und läuft nur noch in eine Richtung. In einer Zangenbewegung werden dann die Flanken nach vorne zu einer Spitze verjüngt, bis das Feuer zum stehen kommt und letztendlich erlischt - soviel zur Theorie.
Dank der Unterstützung eines ortsansässigen Landwirtes konnten die Teilnehmenden auf einem Stoppelfeld die Brandbekämpfung mit Realfeuer erlernen und üben. Bodenfeuer wurden mit Feuerpatschen und Löschrucksäcken bekämpft. Dies ist möglich, bis die Flammen ungefähr Hüfthöhe erreicht haben. Wird das Feuer größer, wird auch die Hitzestrahlung zu hoch und das Feuer kann nur noch aus der Distanz bekämpft werden.
Eine weitere Möglichkeit, die Ausbreitung zu verhindern, sind sog. Wundstreifen. Dabei wird in Laufrichtung des Feuers, aber in sicherer Entfernung auf einer gewissen Breite das brennbare Material entfernt - Wurzeln, Stoppeln, Unterholz - und dem Feuer somit die Nahrung entzogen. Die logische Folge: wo nichts brennen kann, brennt es nicht und das Feuer kommt an diesem Wundstreifen zum Stehen. Die bekannteste Form eines Wundstreifens in unserem Landkreis: der Landwirt zieht mit seinem Grubber einen breiten Streifen über seinen Acker. Dort bleibt das Feuer stehen. Da aber Grubber ober Scheibeneggen nicht immer zur Verfügung stehen, setzen Feuerwehrleute Handwerkzeuge ein, um solche Wundstreifen anzulegen. Sog. Gorguis oder Wiedehopfhacken werden für diese schweißtreibende Arbeit genutzt.
Am Ende des Tages wurde dann aber doch noch ordentlich Wasser genutzt: im sog. "Pump 'n Roll"-Betrieb wurden die Flanken während der Fahrt mit den Tanklöschfahrzeugen abgelöscht. Diese Taktik kann verwendet werden, wenn das Feuer schon so eine Dynamik entwickelt hat, dass eine Brandbekämpfung mit Handwerkzeugen nicht mehr möglich ist. Hier kommen kleine Schläuche, sog. D-Schläuche, zum Einsatz, die mit wesentlich weniger Wasserverbrauch eine effiziente Löschwirkung erzielen.
Am späten Nachmittag ging dieser anstrengende aber lehrreiche Ausbildungstag zu Ende. Die Teilnehmenden nahmen viel neues Wissen mit nach Hause und die Ausbilder waren mehr als zufrieden über die Lernerfolge der knapp 100 Einsatzkräfte.
Der Tag begann am frühen Morgen im Feuerwehrhaus Gusborn. In der Einweisung in die zu bewältigenden Aufgaben betonten die erfahrenen Vegetationsbrand-Ausbilder noch einmal die Besonderheiten von Wald- und Flächenbränden.
Oberste Priorität habe es, sich selbst und die eingesetzten Fahrzeuge zu schützen. Steht ein Feuerwehrfahrzeug bspw. auf brennbarem Untergrund, kann das Feuer bei drehenden Winden schnell auf das Fahrzeug übergreifen und sowohl Gerät als auch die Einsatzkräfte gefährden. Daher ist es besonders wichtig, das Fahrzeug auf nicht brennbarem Untergrund abzustellen, wie bspw. einer Straße oder bereits verbrannter Fläche.
Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass bei einem Vegetationsbrand in unseren Breitengraden erfahrungsgemäß KEINE Menschenleben in Gefahr sind. Es geht also bei der Brandbekämpfung lediglich um Sachwerte und die Gefahr für die Umwelt. Aus diesen Gründen hat die eigentliche Brandbekämpfung gar nicht oberste Priorität. Ein Getreidefeld, was bereits in Brand steht, ist in der Regel sowieso "verloren" - entweder durch das Feuer oder durch das Löschwasser. Und beim Löschwasser liegt der nächste Schwerpunkt: Auf Feldern oder im Wald ist Wasser meist nicht unbegrenzt vorhanden, wie bspw. in einem Wohngebiet. Deshalb ist es ratsam, mit dieser Ressource sparsam umzugehen.
Aus den genannten Gründen sollte sich die Feuerwehr nicht darauf konzentrieren, in erster Linie das Feuer zu löschen. Vielmehr muss die Priorität darauf liegen, eine Brandausbreitung zu verhindern. Und da man sich nie einem Feuer in den Weg stellt, also das Feuer nicht von der Front aus bekämpft, legten die Ausbilder großen Wert darauf, dass im Erstangriff die sog. Flanken eingefangen werden. So wird das Feuer in seiner seitlichen Ausbreitung gehindert und läuft nur noch in eine Richtung. In einer Zangenbewegung werden dann die Flanken nach vorne zu einer Spitze verjüngt, bis das Feuer zum stehen kommt und letztendlich erlischt - soviel zur Theorie.
Dank der Unterstützung eines ortsansässigen Landwirtes konnten die Teilnehmenden auf einem Stoppelfeld die Brandbekämpfung mit Realfeuer erlernen und üben. Bodenfeuer wurden mit Feuerpatschen und Löschrucksäcken bekämpft. Dies ist möglich, bis die Flammen ungefähr Hüfthöhe erreicht haben. Wird das Feuer größer, wird auch die Hitzestrahlung zu hoch und das Feuer kann nur noch aus der Distanz bekämpft werden.
Eine weitere Möglichkeit, die Ausbreitung zu verhindern, sind sog. Wundstreifen. Dabei wird in Laufrichtung des Feuers, aber in sicherer Entfernung auf einer gewissen Breite das brennbare Material entfernt - Wurzeln, Stoppeln, Unterholz - und dem Feuer somit die Nahrung entzogen. Die logische Folge: wo nichts brennen kann, brennt es nicht und das Feuer kommt an diesem Wundstreifen zum Stehen. Die bekannteste Form eines Wundstreifens in unserem Landkreis: der Landwirt zieht mit seinem Grubber einen breiten Streifen über seinen Acker. Dort bleibt das Feuer stehen. Da aber Grubber ober Scheibeneggen nicht immer zur Verfügung stehen, setzen Feuerwehrleute Handwerkzeuge ein, um solche Wundstreifen anzulegen. Sog. Gorguis oder Wiedehopfhacken werden für diese schweißtreibende Arbeit genutzt.
Am Ende des Tages wurde dann aber doch noch ordentlich Wasser genutzt: im sog. "Pump 'n Roll"-Betrieb wurden die Flanken während der Fahrt mit den Tanklöschfahrzeugen abgelöscht. Diese Taktik kann verwendet werden, wenn das Feuer schon so eine Dynamik entwickelt hat, dass eine Brandbekämpfung mit Handwerkzeugen nicht mehr möglich ist. Hier kommen kleine Schläuche, sog. D-Schläuche, zum Einsatz, die mit wesentlich weniger Wasserverbrauch eine effiziente Löschwirkung erzielen.
Am späten Nachmittag ging dieser anstrengende aber lehrreiche Ausbildungstag zu Ende. Die Teilnehmenden nahmen viel neues Wissen mit nach Hause und die Ausbilder waren mehr als zufrieden über die Lernerfolge der knapp 100 Einsatzkräfte.
Quelle: Niedersachsen