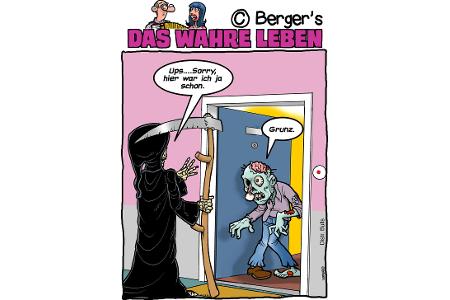Linken-Politikerin warnt in der ARD vor "Herbst der Reformen"
78 Prozent müssen es wissen: So viele sind laut aktueller Infrastest-Umfrage unzufrieden mit Friedrich Merz und seiner schwarz-roten Regierung. Dass die CDU bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen den ersten politischen Stimmungstest mit Ach und Krach bestanden hat, ist da ein schwaches Trostpflaster. "Wir müssen jetzt aber wirklich ins Handeln kommen", betonte Matthias Miersch, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der SPD, die mit 22 Prozent in Merz' Heimat das schlechteste Ergebnis seit 1945 eingefahren hatte.
Er wiederholte damit bei Louis Klamroths erster "Hart aber fair"-Sendung nach der Sommerpause, was der Bundeskanzler als "Herbst der Reformen" angekündigt hatte. Beim Bürgergeld, der Rente und der Krankenversicherung soll gespart werden, um Budgetlöcher von mehr als 170 Millionen Euro zu stopfen. Denn, um erneut Merz zu zitieren: "Wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten."
"Sozialleistungen zu teuer - Bullshit oder bittere Wahrheit?", gab sich Klamroth schon mit dem Titel dieser Talkshowausgabe angriffslustig wie eh und je. Zu welcher Antwort sie tendierte, daraus machte Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und frühere Parteivorsitzende) keinen Hehl: "So ein Satz ist kein Reformvorschlag", fauchte sie, "können wir es uns leisten, dass auf riesige Erbschaften keine Steuer gezahlt wird? Können wir es uns leisten, dass jeder Zweite keinen Notgroschen von 2.000 Euro hat? (...) Das Motto bei Merz ist: Die, die wenig haben, werden ärmer und die, die viel haben, werden geschützt."
Es entstehe der Eindruck, man wolle das Geld "bei den Ärmsten der Armen herausquetschen", warnte auch Katja Kipping (Geschäftsführerin von "Der Paritätische"). Seit 2020 habe sich die Armut verschärft. Jetzt über Kürzungen von Sozialleistungen nachzudenken, "führt zu einer sozialen Verunsicherung und spielt den Feinden der Demokratie in die Hände", verwies die frühere Linken-Parteivorsitzende auf das Erstarken der AfD.
Thorsten Frei (CDU): "Nur über Einnahmen zu sprechen, geht am Thema vorbei"
Widerspruch kam naturgemäß von Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts) und Matthias Miersch (SPD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion). Ihnen versuchte Louis Klamroth beharrlich Antworten auf die "Grundfrage der Sendung" zu entlocken: "Wen treffen die Reformen im Herbst? Wer muss mehr bezahlen, wer bekommt mehr Geld?", stellte er sie immer und immer wieder.
Während Miersch die Erbschafts- und Vermögenssteuer als einen Punkt auf der Tagesordnung der Regierungsparteien betrachtete, sah Frei beim Erben keine Notwendigkeit, Schlupflöcher zu stopfen. Vermögen müsse unterschiedlich bewertet werden, meinte er: Werde Privates vererbt, sei das der Erbschaftssteuer unterworfen. Werde ein Unternehmen vererbt und die Erbschaftssteuer so erhöht, dass dieses verkauft werden müsse, würde man "Innovationen und Strukturpolitik einen Bären erweisen", sprach er sich gegen "Herumdoktern" am Erbschaftssteuerrecht aus. Da brauche es ein Konzept, das passt.
Ein solches hatte Lang parat. "Wir gehen an die Ausnahmen der Erbschaftssteuer ran und investieren es in Schulen und Kitas", schlug sie vor, den Fokus vom hoch besteuerten Einkommen doch auf diese "Schlupflöcher" zu legen.
"So funktioniert es nicht, es gibt keine zweckgebundenen Steuereinnahmen", widersprach Stella Pazzi (geschäftsführende Gesellschafterin des Saarbrücker Software-Unternehmens Moltomedia). Die Unternehmerin zeigte sich enttäuscht von den Diskussionen über Mehr-Einnahmen. "Wie viel Geld wollen wir noch?", stünden schon so viel Steuereinnahmen wie nie zuvor zur Verfügung. Wichtiger sei die Frage: "Was machen wir damit?" Vieles verpuffe in der Bürokratie, statt in wirtschaftsfördernde Reformen - und sie traue es dem Staat momentan nicht zu, mit den Geldmitteln effizient und effektiv umzugehen.
Im Herbst der Reformen gehe es ja nicht nur um Sozialreformen, sondern auch um Energiepolitik, Bürokratieabbau und darum, den Unternehmen nicht "Stöcke in die Speichen zu stecken", betonte Frei und sah sich zumindest in einem bestätigt: "Nur über Einnahmen zu sprechen, geht am Thema vorbei." "Finde ich nicht", trotzte Klamroth, tat dem Unions-Politiker aber dann doch den Gefallen, über die Ausgaben zu reden.
Marcus Weichert: "Einsparungen durch Bürokratieabbau (...) deutlich nachhaltiger"
Ursprünglich 30 Milliarden Euro wollte Merz beim Bürgergeld einsparen, jetzt wird mit fünf Milliarden kalkuliert. "Ausgerechnet in einer Zeit, in der die Konjunktur schwächelt, über Einsparungen zu reden", hielt Marcus Weichert (Geschäftsführer Jobcenter Dortmund) das für fragwürdig. Vielmehr sollte man an "Bürokratie- oder Dokumentationskosten (...) rangehen", empfahl er, "dann würden wir mittelbar Einsparungen haben, die auf lange Sicht deutlich nachhaltiger" seien. Zudem könnten sich Jobcentermitarbeitende auf die Beratung- und Eignungsdiagnostik konzentrieren.
Den "Vermittlungsvorrang", den die Ampelkoalition abgeschafft hat, erneut einzuführen, mache nur bedingt Sinn: Bis zu drei Viertel hätten "keine abgeschlossene oder verwertbare Berufsausbildung, und bei Stellen gehen wir davon aus, dass nur zehn bis 20 Prozent im Angebot für Ungelernte infrage kommen", nannte er Zahlen, "bei einem Verhältnis von 1:20 bis 1:30 würde selbst bei einem Vermittlungsvorrang der Großteil zugucken." Sogenannte "Totalverweigerer" seien ohnehin eine "verschwindend geringe Zahl", die 98 Prozent der Menschen in Misskredit brächten.
In aller Härte gegen Missbrauch vorzugehen, damit war Lang einverstanden. "Aber was Sie vorhaben ist etwas anderes - nicht auf den Einzelnen, sondern auf eine ganze Gruppe", warf sie den schwarz-roten Regierungsvertretern vor. Und überhaupt seien die Renten- und Krankenversicherung größere Posten - "da höre ich bisher nichts". Im Sozialhaushalt 2026 seien tatsächlich 71 % für Rente und Grundsicherung im Alter vorgesehen, bestätigte Klamroth. In der heutigen Sendung ging es dennoch nur ums Bürgergeld.
"Warten wir erst mal ab", bat Miersch sich zu gedulden, bis der konkrete Gesetzesentwurf stehe. Die Transferleistung selbst bei den wenigen Totalverweigerern dauerhaft auf null zu setzen, konnte er sich - anders als Frei und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann - jedoch nicht vorstellen.
Dass bei der Überarbeitung des Bürgergelds noch vieles offen sei, bestätigte auch Frei. So habe man sich zwar auf den allgemeinen Vermittlungsvorrang verständigt, "aber den kann man pragmatisch ausgestalten". Es sei der richtige Ansatz, den Jobcentermitarbeitenden auch Instrumente wie Sanktionsmöglichkeiten in die Hand zu geben. Genau das hatte sich Weichert zuvor gewünscht - das, und Bürokratieabbau, versteht sich.