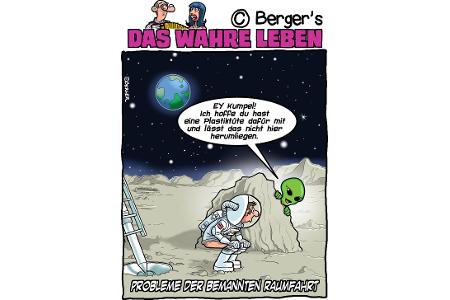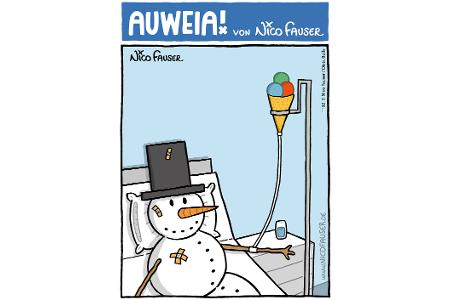Collien Ulmen-Fernandes besuchte Kambodschas Textilfabriken

Made in anderswo - die Zustände in Textilfabriken armer Länder stehen selten im Fokus. Collien Ulmen-Fernandes will das mit der RTL II-Doku "Echtzeit" ändern. Warum nicht allein Discounter an den schlechten Arbeitsbedingungen schuld sind und weshalb Boykott nichts bringt, erzählte sie im Interview.
Alles spricht über die Flüchtlingskrise, doch nun will Collien Ulmen-Fernandes (34, "Ich bin dann mal Mama" ) auf ein anderes wichtiges Thema aufmerksam machen: Für die "Echtzeit"-Dokumentation "Hoher Preis für billige Klamotten" (am Montag, den 28.9. um 23:15 Uhr bei RTL II) machte die Moderatorin und Schauspielerin sich auf die Reise nach Kambodscha, wo in mehr als 400 Textilfabriken Kleidung der westlichen Modemarken produziert werden. Stellvertretend für Deutschlands junge Konsumenten nahm sie zwei modebewusste Teenager mit, die den Ursprung ihrer Kleidung hautnah miterleben sollten.
Billig gleich schlecht?
Was ihre Begleiterinnen vor allem überraschte, war, welche Labels sie vorgefunden haben, wie Ulmen-Fernandes der Nachrichtenagentur spot on news erzählte. "Viele sind der Auffassung, dass vor allem Discounter in Billigländern produzieren. In der Realität ist es aber so, dass fast die gesamte westliche Kleidungsindustrie in diesen Ländern produziert", erklärt sie. Die Luxuswarenhersteller hätten sogar teilweise schlechtere Bedingungen in ihren Fabriken als die Discounter.
"Die Leute haben verinnerlicht: Billig gleich schlecht", sagt Ulmen-Fernandes. Doch sei es bei einem Lohnanteil von etwa 18 Cent pro T-Shirt selbst bei Discount-Ware ein Leichtes, das Doppelte oder Dreifache zu zahlen. Doch seien die Unternehmen zu sehr "auf Gewinnmaximierung getrimmt". "Die soziale Verantwortung wird dabei völlig außer Acht gelassen.
Boykott? "Auf keinen Fall"
Auch die Verbraucher sind deshalb gefragt. Boykott sei allerdings "auf keinen Fall" der richtige Weg, wie Ulmen-Fernandes sagt. "Was ein Boykott zur Folge hätte, hat man während der Finanzkrise gesehen, als weniger gekauft wurde. Damals mussten diverse Fabriken schließen und die Näherinnen und Näher landeten auf der Straße. Die Menschen vor Ort sind auf die Jobs angewiesen. Man muss aber dafür sorgen, dass die Bedingungen besser werden." Stattdessen gilt es, Augen und Mund aufzumachen und die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen.
Dass dieses Thema inmitten des Flüchtlingsstroms leicht untergehen kann, ist Ulmen-Fernandes bewusst. "Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch eine neue Menschlichkeitswelle entstanden ist", sagt sie. "Vielleicht fangen die Menschen nun auch an, darüber nachzudenken, wer ihre Jeans genäht hat."