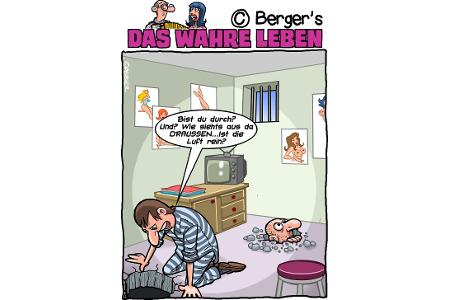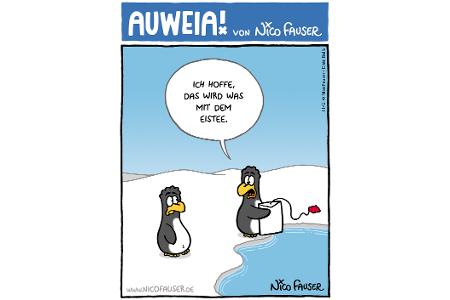Michael Verhoeven: "Ich will nicht zum Spezialisten für irgendwas werden"

Nach Filmen wie "Die Weiße Rose" und "Das schreckliche Mädchen" hat sich Michael Verhoeven mit "Let's go!" wieder an einen Film über den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach gewagt. Dabei ist es gar nicht die Absicht des Regisseurs, immer wieder zu diesen Themen zurückzukehren. Warum er Laura Wacos Buch "Von Zuhause wird nichts erzählt" dennoch adaptiert hat, erzählt er im Interview.
In "Let's go!" (am Freitag, 10. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten) erzählt Michael Verhoeven die Geschichte von Laura (Alice Dwyer), die nach dem Tod ihres Vaters aus den USA in ihre Heimat München zurückkehrt und mit Erinnerungen und Verletzungen ihrer Kindheit konfrontiert wird. Denn ihre Eltern, beide Überlebende eines Konzentrationslagers, haben ihre Kinder mit einer vom eigenen Trauma geprägten Angst erzogen - schwankend zwischen erdrückender Liebe, großer Strenge und kühler Distanz.
Holen Sie sich hier Laura Wacos Buchvorlage "Von Zuhause wird nichts erzählt"
"Let's go!" basiert auf Motiven aus Laura Wacos autobiografischer Erzählung "Von Zuhause wird nichts erzählt". Obwohl Verhoeven keinen Film über den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach mehr machen wollte, ließ er es sich nicht nehmen, Wacos Buch selbst zu adaptieren. Warum ihn die Geschichte so bewegte und welche Erinnerungen er an seine eigene Kindheit in der Nachkriegszeit hat, erzählt der Regisseur im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.
Sie haben in Ihrer Jugend selbst mit vielen Displaced Persons unter einem Dach gelebt. Hat Sie das geprägt?
Michael Verhoeven: Wenige Wochen nach dem Krieg hat die amerikanische Militärregierung meinen Vater Paul Verhoeven zum Intendanten des Bayerischen Staatsschauspiels gemacht. Deswegen wurde unsere Familie in München in einer größeren Pension für Displaced Persons untergebracht. Also lebten wir eine Zeit lang mit diesen verstörten jüdischen Familie. unter einem Dach. Da waren auch jüdische Kinder. Obwohl ich deren Sprache nicht verstand, habe ich doch ihre Situation begriffen.
Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Verhoeven: Ich war damals sieben Jahre alt, und diese erste Zeit nach dem Krieg und die Begegnung mit den jüdischen Familie., die einen Neuanfang suchten, hat schon einen großen Eindruck auf mich gemacht. Später haben die Amerikaner uns dann in Harlaching untergebracht - hier mussten Nazis für unsere Familie aus dem Haus ausziehen. Dass das in der Umgebung nicht gut ankam, kann man sich vorstellen.
Gab es dann Spannungen?
Verhoeven: Ja, als Kind war mir das aber nicht so bewusst. Ich fand es einfach recht so, dass die da rausfliegen. Wahrscheinlich haben meine Eltern schon mehr Druck gespürt. Es war jedenfalls eine sehr aufregende Zeit. Gerade für Kinder, die ja nichts in Frage stellen. Ich habe wirklich lange Zeit gedacht, dass man eben auf den Schwarzmarkt geht, wenn man Tee oder Bohnenkaffee kaufen will. Das war ganz normal für mich.
Offenbar hat diese Zeit Sie sehr geprägt, denn es ist nicht der erste Film, den Sie über den Krieg oder die Nachkriegszeit machen.
Verhoeven: Ich frage mich selbst oft, warum ich immer wieder zu diesen Themen zurückkomme. Denn ich habe jedes Mal das Gefühl: "Nie wieder." Ich will nicht zu einem Spezialisten für irgendetwas werden - egal, für was. Ich will in Bewegung bleiben, dennoch lande ich immer wieder bei diesem Thema. Vielleicht auch, weil es so viel mit meiner Kindheit zu tun hat.
Warum haben Sie dieses spezielle Thema machen wollen? Sie haben ja sogar Laura Wacos Buchvorlage selbst adaptiert.
Verhoeven: Die Autorin hat mir das noch als Manuskript gegeben, weil sie in Los Angeles "Das schreckliche Mädchen" gesehen hatte und daraufhin wollte, dass ich aus ihrem Buch einen Film mache. Ich habe ihr gesagt, sie solle sich erst einmal einen Verlag suchen und mir das fertige Buch dann schicken. Als ich das gelesen habe, wusste ich, das wird mein nächster Film. Ich hatte das Gefühl, das zu kennen, was sie beschreibt, und auch sie zu kennen.
Wie eng war der Kontakt zu der Autorin Laura Waco, während Sie an dem Film gearbeitet haben?
Verhoeven: Ich habe sie in der Phase der Drehbuchentwicklung ein paar Mal in Los Angeles besucht. Heute lebt sie ja in New York. Sie war auch ein paar Mal hier bei uns. Wir haben viel miteinander gesprochen und uns richtig angefreundet. Obwohl sie auf diese Weise einige Drehbuch-Versionen kennengelernt hat, war mein Eindruck, dass sie mich einfach machen lässt. Sie hat mir vertraut.
Wie ist es als Filmemacher, die Geschichte einer Person zu erzählen, die man dann auch noch selbst kennenlernt?
Verhoeven: Ich kannte das gewissermaßen schon von "Die Weiße Rose" (1982). Meine ersten Drehbuchfassungen waren damals komplett anhand von Geschichtsbüchern entstanden - ich kannte ja niemanden von der Weißen Rose. Dann wollte ich aber doch zumindest das Einverständnis der Angehörigen haben, ihnen wenigstens sagen, was ich vorhabe. Die haben mich aber total abprallen lassen, denn sie wollten keinen Film über die Weiße Rose. Letztendlich hat Anneliese Graf, die Schwester von Willi Graf, dann doch gemerkt, dass mein Ansatz ganz gut sein könnte, und mir die Türen geöffnet. Als ich daraufhin mit den Leuten gesprochen habe, war schnell klar, dass ich eigentlich alles aus den Geschichtsbüchern wegwerfen konnte. Da habe ich gelernt, sorgsam mit dem umzugehen, was Familie. wirklich erlebt haben.
Der Titel von Laura Wacos Buch ist "Von Zuhause wird nichts erzählt". Trifft dieses große Schweigen nicht auf alle Familie. in der Nachkriegszeit zu, egal, auf welcher Seite?
Verhoeven: Ich habe einmal einen Film über die Verbrechen der Wehrmacht gemacht, "Der unbekannte Soldat" (2006), und bin damit in Schulen gegangen. Diese Teenager hatten zuhause gar nichts darüber erfahren. Was mich auch gar nicht verwundert, denn es hatte ja fast jede Familie einen Onkel, einen Vater oder einen Opa in der Armee. Es ist leichter, darüber zu schweigen.
Wie viel wurde denn bei Ihnen Zuhause erzählt?
Verhoeven: Nun, ich komme aus einer Theaterfamilie und da herrschte eine ganz andere Art von Offenheit gerade politischen Themen gegenüber. Theater befindet sich meist in der Opposition. Wenn ich aber an meinen Freundeskreis denke - da war das tabu, denn das waren zum Großteil Kinder von Nazis. Die konnten solche Gespräche gar nicht führen, denn sie haben zuhause nie über sowas geredet. Die Gesellschaft war zu diesem Thema quasi verstummt.
Und die andere Seite war auch verstummt, weil sie traumatisiert war?
Verhoeven: Natürlich. Deshalb war ich mir so sicher, dass es sich lohnt, diesen Stoff zu verfilmen. Eltern, die aus den Konzentrationslagern kamen, haben ihr Leid auf die Kinder übertragen. Das aber nicht, indem die Kinder den Schmerz der Eltern spüren und dadurch selber leiden. Sondern dadurch, dass diese Kinder verschont werden sollten, indem man sie aus Angst mit tausenden Verboten belegte und sehr streng erzog. Sie sollten möglichst nicht erfahren, dass sie jüdisch sind. Und diese falsche Erziehung, aus der Angst und dem Trauma entstanden, schafft das Leid.
Haben wir als Land dieses kollektive Trauma denn überwunden?
Verhoeven: Es würde mich wundern, wenn es so wäre. Das, was da passiert ist, und was den Juden angetan worden ist, ist die Katastrophe des Jahrhunderts. Da kann ich nicht erwarten, dass diese Wunden so schnell heilen. Das kommt immer wieder hoch.
Sie haben zusammen mit Ihrer Frau Senta Berger eine Produktionsfirma. Warum drehen Sie nicht öfter zusammen?
Verhoeven: Gelegentlich haben wir das ja getan. Aber ich finde es nicht so gut, wenn man als Ehepaar ganz selbstverständlich auch zusammen dreht. Man soll so gut wie möglich besetzen, aber nicht unbedingt immer in der Familie.
Steckt dahinter auch der Wunsch, Privates und den Beruf doch ein bisschen zu trennen?
Verhoeven: Nein, das tun wir nicht. Das können wir gar nicht. Der Beruf nistet sich ja in allen Ecken des Privatlebens ein.
Nimmt Senta Berger Einfluss auf Ihre Arbeit, selbst wenn sie wie hier nicht an dem Projekt beteiligt ist?
Verhoeven: Sie redet selbstverständlich mit, weil ich ja mit ihr darüber rede. Aber Einfluss - wahrscheinlich tut sie es doch, ohne dass ich es überhaupt merke. Aber dazu ist man ja zu zweit.