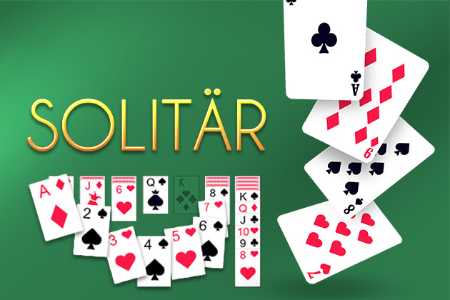Bei ihrem Selbstversuch begreift ARD-Reporterin, warum junge Deutsche wieder vermehrt rauchen
"Keine Ahnung, die wievielte das jetzt war, aber reicht eigentlich auch", sagt ARD-Reporterin Sophie Labitzke in die Kamera. Dann drückt ihre letzte Zigarette aus. Elf Jahre lang hat sie geraucht, bis zu 20 Zigaretten am Tag. Sie will endlich damit aufhören, doch das ist gar nicht so einfach, denn überall wird sie mit ihrer Sucht konfrontiert, stellt Labitzke fest: Aschenbecher, Raucherzonen am Bahnhof oder Zigarettenstummel auf der Straße - Rauchen ist präsent und beliebt.
Die Reporterin begibt sich in der neuen Reportage "Y-History: Warum kein Rauchverbot?" auf Spurensuche, spricht mit Experten und anderen Betroffenen und startet einen Selbstversuch: Schafft sie es, mit dem Rauchen aufzuhören?
Laut Bundesgesundheitsministerium rauchen etwa 20 Prozent der deutschen Bevölkerung, auch junge Menschen fangen wieder vermehrt an. Dabei sind die Gefahren, die Zigarettenkonsum mit sich bringt, seit Jahrzehnten bekannt.
"Dass sie nicht gesund war, war eigentlich jedem klar"
Bereits die Nationalsozialisten forschten zur Gefahr von Tabak, wie die Doku aufschlüsselt. Bis Anfang der 70er-Jahre war diese in mehreren Studien bewiesen worden. "Der Höhepunkt des Zigarettenabsatzes in Deutschland war 1981. Das knickte erst ab, als massive Steuererhöhungen innerhalb von zwei, drei Jahren kamen", erklärt Historiker Dirk Schindelbeck der ARD-Reporterin.
Der Zigaretten-Hype begann Anfang des 20. Jahrhunderts: Für Frauen der 20er- und 30er-Jahre wurde sie zu einem Zeichen der Emanzipation, während des Ersten Weltkriegs waren sie die Währung der Schützengräben. "Es war ein ganzer Kosmos, den die Zigarette abgebildet hat. Die war überlebenswichtig", berichtet Schindelbeck.
Rauchen stand entgegen der nationalsozialistischen Ideale, komplett verboten wurden es dennoch nicht, da Aufstände befürchtet wurden und der Einfluss der Industrie zu groß gewesen wäre, erklärt der Historiker weiter. Im Nachkriegsdeutschland wurde die Zigarette wieder zur Währung und erfreute sich in den folgenden Jahrzehnten wachsender Beliebtheit. Ob die Menschen damals schon um die Gefahren gewusst hätten, will die Reporterin wissen. "Wie gefährlich vermutlich nicht. Dass sie nicht gesund war, war eigentlich jedem klar", antwortet der Historiker.
Risikofaktor Rauchen: "Das war erst mal ein Schlag vor den Bug"
Jung und Alt, Ost und West, überall war und ist Rauchen gesellschaftlich akzeptiert. "Die Zigarette war in der Gesellschaft so präsent, dass man gar nicht wahrgenommen hat, ob man krank wird oder nicht", erinnert sich Frank Denecke, der Mitte der 60er-Jahre geboren wurde. Insgesamt 40 Jahre rauchte er. "Am Ende waren es zwei Big Packs am Tag", gibt er zu.
Erst die Diagnose Kehlkopfkrebs brachte Frank zum Aufhören. "Das war erst mal ein Schlag vor den Bug", erinnert er sich. Seine Stimme ist rau und kratzig, denn er ist nach der Entfernung seines Kehlkopfes auf eine Prothese angewiesen. Rauchen ist neben Alkohol einer der Hauptrisikofaktoren für Kehlkopfkrebs und weitere Atemwegserkrankungen.
Nach ihrem Gespräch mit Frank sei ihr "erst mal weniger nach einer Kippe", sagt die Reporterin. Trotzdem wird es für sie nicht leichter, auf Zigaretten zu verzichten. "Ich habe vom Rauchen geträumt", gibt die Reporterin zu. "Tabak, Zigaretten und Co. werden popkulturell noch krass gehypt", findet Labitzke - "und genau das ist das Problem".
Rauchen in Deutschland: "Man muss es den Leuten ja nicht so leicht machen"
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisierte unter anderem, dass Zigaretten in Deutschland zu günstig seien. Die Bundespolitikerin Linda Heitmann von den Grünen sitzt im Gesundheitsauschuss und sieht ebenfalls Handlungsbedarf, wie sie Labitzke erklärt. Man müsse immer wieder prüfen, "lässt sich da nicht noch was regulieren, um weniger Anreiz zum Rauchen zu schaffen?"
Jan Mücke vom "Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse" kritisiert im Gespräch mit der ARD-Reporterin die "fehlende Regulierung" für alternative Nikotinerzeugnisse. Durch die Legalisierung von Snus, E-Zigaretten und Tabak-freien Nikotinbeuteln hätte es beispielsweise Schweden geschafft, die Raucherquote auf sechs Prozent zu senken. Ab einer Quote von unter fünf Prozent gilt ein Land als rauchfrei.
Dabei sind auch diese Produkte nicht ungefährlich, denn auch sie machen abhängig. Das macht sich im Vorzeigeland Schweden bemerkbar. "Der Nikotinkonsum unter Jugendlichen hat tatsächlich zugenommen, vor allem bei jungen Frauen", erklärt Forscherin Louise Adermark, als Labitzke sie in Göteborg besucht. Dennoch, "in Schweden werden Zigaretten eher negativ gesehen", so Adermark weiter. Das wäre durch "alle möglichen Vorschriften" erreicht worden.
Doch ob das auch in Deutschland funktioniert? "Man muss es den Leuten ja nicht so leicht machen", findet Reporterin Labitzke. Zum Ende der Dokumentation hat sie bereits 56 Tage ohne Zigarette geschafft. Darauf sei sie "mächtig stolz".
"Y-History: Warum kein Rauchverbot?" ist in der ARD-Mediathek verfügbar und am Montag, 4. August, 23.05 Uhr, im Ersten zu sehen.