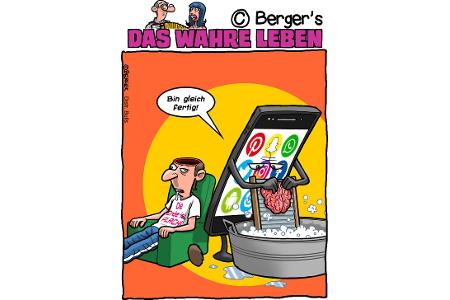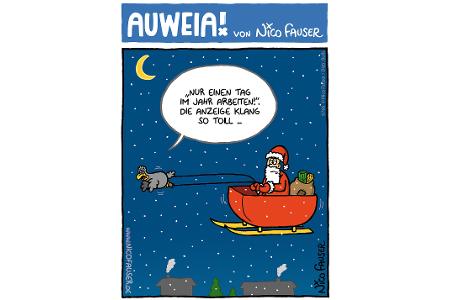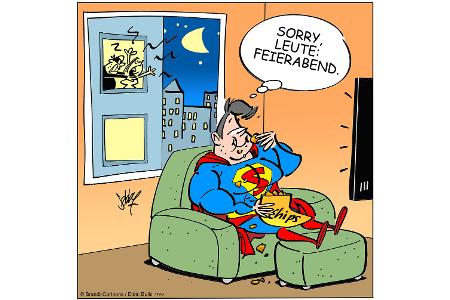Doku zeigt, warum Deutschland ein "Geldwäsche-Paradies" ist

Deutschland ist eine der größten Vollkswirtschaften weltweit - und gleichzeitig ein wahres Geldwäsche-Paradies. Das wissen Behörden, die Politik, aber auch Kriminelle. Die ARD-Dokumentation "Dirty Money - Geldwäsche-Paradies Deutschland" zeigt, wie Milliarden aus Drogenhandel, Terrornetzwerken und organisierter Kriminalität täglich in den deutschen Wirtschaftskreislauf fließen. Und was andere Länder besser machen.
Geldwäsche, so erfährt man im vom WDR produzierten Film, wird in drei Phasen eingeteilt: Einspeisung - Verschleierung - und Integration in den legalen Geldhandel. Katrin Wilhelm ist Geldwäsche-Beauftragte einer Bank. Sie beschäftigt sich vor allem mit der ersten Phase der Geldwäsche, der Einspeisung, und agiert als "Alarmglocke einer Bank". Die Einspeisung erfolge, so Wilhelm, "indem ich Bargeld integriere, und zwar in Bargeld-intensiven Branchen, so nennen wir das in der Geldwäsche."
"Was da rauskam, war erstaunlich"
Sie nennt als Beispiel den Fall zweier Brüder, die einen kompletten Restaurant-Betrieb vortäuschten, um Geld zu waschen. Wie sich herausstellte, waren die Männer in Waffenhandel, Drogen und illegales Glücksspiel verwickelt. Das vermeintlich im Restaurant durch Gäste erworbene Bargeld wollten sie dann auf einer Bank in ihr Konto einzahlen lassen. Der Haken: Es gab überhaupt keine Gäste. Zwar seien regelmäßig hochwertige Lebensmittel eingekauft, diese dann aber wieder unbenutzt entsorgt worden. "Man geht davon aus, dass sie so über eine Million im Jahr haben waschen können", erklärt Wilhelm.
Aufgeflogen seien die Männer letztlich durch den Hinweis einer aufmerksamen Nachbarin. Das Finanzamt führte daraufhin eine routinemäßige Überprüfung durch und stellte fest, dass die Kasseneingänge nicht dem tatsächlichen Bild entsprachen. Auch der Abfallhof sei misstrauisch geworden, meldete, dass von dem Restaurant gute Lebensmittel entsorgt worden seien. Die Behörden griffen schließlich ein. "Was da rauskam, war erstaunlich", erinnert sich Wilhelm. So sei Kokain in den Gefriertruhen und im Inventar verstecktes Bargeld in Höhe von 1,2 Millionen Euro gefunden worden. Zudem hätten die Ermittler im Keller Waffen gefunden, die sofort beschlagnahmt wurden.
Kriminologin spricht von "Schwachstellen im System"
Doch was macht Deutschland als Standort so attraktiv für Geldwäscher? Zora Hauser ist Kriminologin und forscht an der Universität Cambridge zu Mafia und Geldwäschenetzwerken. Sie sieht vor allem ein großes Problem: "Bargeld ist in Deutschland ein sehr schwieriges Thema. Kulturell besteht der Deutsche sehr darauf, Bargeld zu benutzen." So sei es manchmal schlichtweg nicht möglich, anders zu bezahlen. "Man muss Bargeld immer dabei haben und Bargeld wird benutzt - jeden Tag." Die Herausforderung sei es, aus der Menge der Transaktionen die herauszufinden, die illegal passierten. "Das Problem ist ja nicht, dass man Bargeld benutzt, sondern, dass es kein Bargeld-Limit gibt in Deutschland."
Wer Beträge über 10.000 Euro bar bezahlen will, muss sich zwar ausweisen und erklären, woher das Geld stammt, doch die Händler sind nur verpflichtet, die Angaben aufzubewahren. Melden müssen sie sie nicht. Dass im Alltag so oft niemand eine zweite Frage stellt oder hohe Bargeld-Ausgaben anzeigt sei, so Hauser, eine der "Schwachstellen im System".
In den Nachbarländern ist das Vorgehen oft anders. Beispielsweise in den Niederlanden. Wenn dort bei einer Kontrolle eine höhere Menge Bargeld festgestellt wird, ist der Inhaber in der Pflicht nachzuweisen, dass das Geld legal erwirtschaftet wurde, betont Michael H., GFG-Ermittler beim Zollkriminalamt.
"Deutschland ist für die organisierte Kriminalität ein sehr guter Spielplatz"
In Deutschland ist das nicht der Fall. Tanja M, Kriminalbeamtin beim BKA betont: "Was wir uns wünschen, ist die Beweislastumkehr. Aber das gibt es im Strafrecht nicht, im Strafrecht muss ich ja immer nachweisen, dass das nicht in Ordnung ist, was der macht." Auch Jürgen Roßbach, GFG-Leiter beim Bundeskriminalamt bis 2025 spricht sich für eine Beweiserleichterung aus. Ein Punkt, den auch Zora Hauser vertritt: "Es gibt Gründe, warum Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist, denn es ist unglaublich schwierig, den Kriminellen das Geld wegzunehmen". In den Niederlanden, oder in Italien sei das nicht der Fall.
Die Kriminologin betont, der Staat solle die Möglichkeit einer Beschlagnahmung haben, wenn bei einer Kontrolle eine auffällig hohe Bargeldsumme entdeckt werde: "Ich weiß nicht, ob das so radikal ist, wie wir denken". Die Kriminologin merkt an, dass die wenigsten Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag das Problem hätten, erklären zu müssen, wie sie an "eine Million Cash" kommen. Die Konsequenzen sind verheerend: "Das System ist so ineffizient, dass Deutschland zum Geldwäsche-Paradies wurde", stellt Hauser klar: "Deutschland ist für die organisierte Kriminalität ein sehr guter Spielplatz."
Katrin Wilhelm weiß: "Alles, was bargeldintensiv ist, kann potenziell zur Geldwäsche missbraucht werden." Restaurant, Nagelstudios, Spielhallen, Kioske - "Die Liste ist lang". Zwar sei man durch einen solchen festen Standort stets sichtbar für die Behörden, die Geldwäsche-Beauftragte gibt jedoch zu bedenken: "In der Regel, wenn es den Umsätzen entsprechen passend ist, ist die Aufdeckungschance für die Behörden relativ gering und das passiert sehr, sehr selten." Sie führt aus: "Deswegen gibt es kriminelle Strukturen. (...) Es geht, also machen sie es. Es gibt zu wenig Überwachung und sie werden nicht damit aufhören, weil es halt einfach möglich ist."