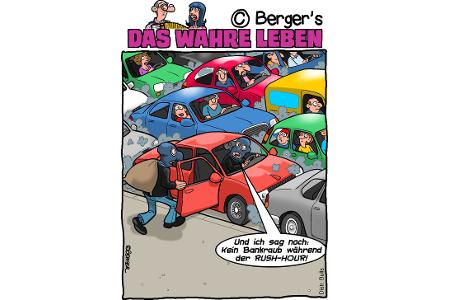"Die Brücke am Ibar": Kann die Liebe alles überwinden?

Michaela Kezele erzählt in ihrem vielfach ausgezeichneten Regie-Debüt "Die Brücke am Ibar" eine berührende Liebesgeschichte in Zeiten des Kriegs. Im Doppelinterview mit Schauspieler Misel Maticevic erklären die beiden, ob sie daran glauben, dass die Liebe den Hass überwinden kann.
Der Plot: Kosovokrieg, 1999 - Die serbische Witwe Danica (Zrinka Cvitesic) lebt mit ihren Söhnen in einer Siedlung, die der Fluss Ibar in einen serbischen und einen albanischen Teil unterteilt. Seit der Ermordung ihres Ehemanns durch albanische Soldaten haben sich die Söhne Danilo und Vlado völlig verändert. Danilo spricht nicht mehr und Vlado schwänzt die Schule. Als sich der schwerverletzte albanische UCK-Soldat Ramiz (Misel Maticevic) in Danicas Vorgarten rettet, steht sie vor der Wahl: Liefert sie ihn an die serbische Miliz aus oder pflegt sie ihn gesund? Sie rettet den Mann und bringt sich und ihre Söhne damit in Lebensgefahr...
Klingt nach schwerer Kost und das ist "Die Brücke am Ibar" (5.7., 22.45 Uhr, das Erste) auch. Doch ist der Film mit so liebevoller und leichter Hand erzählt, dass in den kriegsfreien Momenten eine schöne sommerliche Unbeschwertheit durchscheint. Und genau darum, um "die vielen einzelnen Schicksale der Menschen, die nichts damit [dem Krieg] zu tun haben wollen", geht es Regisseurin Michaela Kezele (*1975) in ihrem Filmdebüt auch. Im Doppelinterview mit Schauspieler Misel Maticevic (*1970, "Wir waren Könige") erklärt die gebürtige Münchnerin der Nachrichtenagentur spot on news außerdem, warum sie daran glaubt, dass die Liebe auch solche Konflikte überwinden kann.
Was bedeutet der Film für Sie?
Michaela Kezele: Es war mir wichtig zu zeigen, dass Kriege nicht nur die abstrakten Bilder und die unüberschaubaren Zahlen der Toten aus den Nachrichten sind. Vielmehr sind es die vielen einzelnen Schicksale der Menschen, die nichts damit zu tun haben wollen, aber zur falschen Zeit am falschen Ort leben. Ich wollte diesen Menschen ein Gesicht geben.
Misel Maticevic: Ich mochte das Drehbuch und die Rolle sehr und die Art und Weise, wie Michaela Kezele bis dahin gearbeitet hat. Für mich persönlich eine meiner feinsten Arbeiten.
Warum ist es wichtig, diese Geschichte zu erzählen? Wie ist die Situation dort heute?
Kezele: Die Situation ist ruhig, aber man spürt, dass unter der scheinbar normalen Oberfläche noch viel Hass ist.
Maticevic: Mir fällt es schwer, die Situation aus der Entfernung zu beschreiben.
Das Denken und Unterteilen in Nationalitäten und Religionen bringt viel Unheil. Könnte das eine Message des Films sein?
Kezele: Ich halte wenig von Unterteilungen. In Betracht auf den aktuellen EU-Austritt der Briten, denke ich, dass wir leider viel zu oft vergessen, wie glücklich wir uns schätzen können, so lange in Europa ohne Kriege zu leben. Dies ist nicht so selbstverständlich, wie wir gerne denken.
Maticevic: Ich schließe mich Michaela an, aber schlussendlich muss jeder Zuschauer für sich selbst entscheiden, was er in dem Film finden will.
Das Paar, das eigentlich keines sein darf... Kann die Liebe solche Feindschaft überwinden oder wäre das zu schön, um wahr zu sein?
Maticevic: Es ist zu hoffen, dass so etwas möglich ist. In unserer heutigen Zeit, in der die Menschen anscheinend andauernd suchen, ohne finden zu wollen, finde ich das eher sehr schwierig.
Kezele: Die Liebe kann alles überwinden. Mein Vater ist Kroate und meine Mutter Serbin, sie sind seit über 40 Jahren glücklich verheiratet. Es gab aber auch "gemischte" Ehen, die sofort nach Beginn des Krieges geschieden wurden, sogar ganze Dörfer wurden absurderweise geschieden.
Wie kann der Wunsch nach Rache verschwinden?
Maticevic: Wenn die Menschen begreifen, dass wir gleich sind, unabhängig von Rasse, Religion, Kultur usw. und dass sich unser Leid und Verlust nicht voneinander unterscheiden, könnte es möglicherweise verschwinden.
Kezele: Ich bewundere Menschen, die Familienmitglieder verloren haben und verzeihen können. Ich finde es auch falsch, ein ganzes Volk für Kriege zu beschuldigen, egal, um welches Volk oder welche Kriege es geht.
Sehr berührend ist auch das Drama um die Kinder, die Uran-Munition und die Leukämie. Inwieweit ist das aufgeklärt? Gibt es die Problematik heute noch?
Kezele: Die NATO hat im März 2000 zum ersten Mal zugegeben, Munition mit angereichertem Uran im Kosovo-Krieg eingesetzt zu haben. Über die Folgen wird bis heute geschwiegen. Diese und ähnliche Probleme wird es geben, solange es Kriege gibt.
Es ist das Filmdebüt von Michaela Kezele: Worin unterscheiden sich Debüt-Drehs von Drehs mit erfahreneren Filmemachern?
Maticevic: Es gibt für mich keinen Unterschied in meiner Arbeit, ob ich in einem Debütfilm spiele oder mit einem erfahreneren Regisseur arbeite, da immer mit aller Energie und Konzentration gearbeitet werden sollte.
In welcher Sprache wurde der Film gedreht? War das eine Herausforderung?
Kezele: Der Film wurde in Serbisch und Albanisch gedreht. Für Misel Maticevic und seine Partnerin Zrinka Cvitesic, die beide weder aus Serbien noch aus Albanien stammen, war es eine ziemliche Herausforderung, auf die Eigenarten der beiden Sprachen zu achten, die sie großartig gemeistert haben.
Maticevic: Die größte Herausforderung war für mich, das Serbische mit einem albanischen Akzent zu färben.
Faszinierend sind auch die Gegend und die Lebensumstände. Karg, einfach, aber schön. Könnten Sie sich vorstellen, dort zu leben?
Kezele: Wir haben in der Umgebung von Belgrad gedreht. Faszinierend fand ich: Je weniger die Leute haben, desto großzügiger und herzlicher waren sie uns gegenüber. Gutmütige Menschen machen jede noch so karge Gegend schön und lebenswert. Dort leben werde ich nicht, aber als nächstes drehe ich wieder in Serbien (und Kroatien).
Maticevic: Ich mochte ähnlich wie Michaela das Großzügige und Freundliche der Menschen dort, aber mir wäre es zu karg.