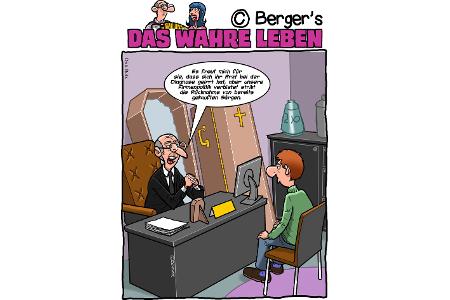Fehler im Stuttgart-"Tatort"

Beim Überfall auf einen Supermarkt wird der Täter von einem Kommissar erschossen. Wer ermittelt? Das kommt darauf an: Im "Tatort: Eine Frage des Gewissens" ebendieser Kommissar, in der Realität in aller Regel nicht - einer der beiden inhaltlichen Fehler im Quotenerfolg vom Sonntag.
Die Drehbuchautoren Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser haben mit "Tatort: Eine Frage des Gewissens" (23.11., 20.15 Uhr, das Erste) solide Krimi-Unterhaltung abgeliefert. Der Lohn: Die 10-Millionen-Marke wurde zum zweiten Mal in der Stuttgart-"Tatort"-Historie geknackt. Doch so ganz koscher war der TV-Film inhaltlich nicht, denn sowohl Kommissar Thorsten Lannert (Richy Müller) als auch Kommissar Sebastian Bootz (Felix Klare) ermittelten in zwei Todesfällen in denen je einer von ihnen verwickelt war.
In der Realität wären die beiden ziemlich sicher nicht mit der Aufklärung der Fälle betraut worden. Lannert hatte einen jungen Mann mit dem sogenannten finalen Rettungsschuss getötet, der bei einem Überfall auf einen Supermarkt drohte, einen Sicherheitsmann zu erschießen. Im Laufe des Krimis befragte der Kommissar unter anderem auch die Mutter des von ihm getöteten Mannes.
Auch Kommissar Bootz hat sich verdächtig gemacht, denn er hat das zweite Opfer sterbend in dessen Wohnung gefunden, obwohl die Frau als Hauptbelastungszeugin gegen seinen Kollegen aussagte. Ermitteln Polizisten in Fällen, in die sie so stark persönlich verwickelt sind? In der Realität in aller Regel nein, in der Fiktion ja! Der Volksmund spricht von Befangenheit.
Doch bei Polizeibeamten gibt es keine Befangenheit im klassischen Sinne wie bei einem Richter. Polizeibeamte sind in einem Ermittlungsverfahren lediglich der ausführende Arm der Staatsanwaltschaft, dessen Erfüllungsgehilfen. Ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch für einen Beschuldigten, diese abzulehnen, existiert nicht. Theoretisch und rein formal juristisch dürften sie also ermitteln. Jedoch gibt es ein großes Aber: Wenn der Fall vor Gericht zur Verhandlung kommt, wird der zuständige Strafrichter sämtliche Beweise, die von einem in den Fall involvierten Polizisten stammen, nicht akzeptieren. Juristen sprechen dann von einem Beweisverwertungsverbot.
Sie sind deswegen wertlos, da der Polizist während der Ermittlung nicht objektiv gewesen sein kann, weil er selbst als Verdächtiger gilt oder weil ihm einer der Zeugen (oder auch das Opfer oder ein Verdächtiger) - aus welchen Gründen auch immer - privat sehr nahe steht. In solch einem Fall wird also in aller Regel und völlig automatisch, die zugehörige Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld den Fall an eine andere Polizei-Dienststelle vergeben, die keinerlei Nähe zu dem Fall aufweist. Gleiches gilt übrigens auch für eine "befangene" Staatsanwaltschaft, die den Fall im wahren Leben sofort abgeben würde.
In diesem konkreten Fall hieße das: Alle von den Stuttgarter Polizisten gesammelten Beweise, alle geführten Vernehmungen, alle geschlossenen Indizienketten - sei es für den Überfall oder die anschließende Tötung - wären vor Gericht vollkommen wertlos. Die Beschuldigten könnten so vor Gericht einem Freispruch entgegen sehen.