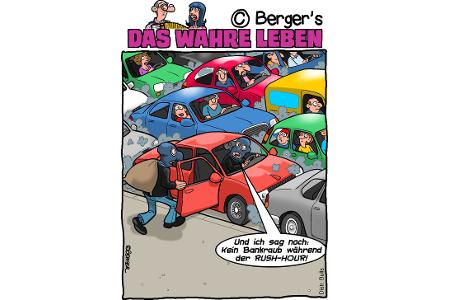So wird der "Tatort" am Sonntag

Das Team vom Bodensee stößt im Fall "Rebecca" auf eine psychische Herausforderung. Ein einst entführtes Mädchen wurde zu absolutem Gehorsam erzogen. Als die brennende Leiche ihres Peinigers aufgefunden wird, sitzt es verstört daneben. Ein bewegender Fall, der nichts für sensible Gemüter ist.
Am 10. Januar läuft der vorletzte Fall des Konstanzer Ermittler-Duos Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel). In "Rebecca" (20.15 Uhr, das Erste) werden die Kommissare mit einer psychischen Grenzsituation konfrontiert: Ein kleines Mädchen wurde entführt und über die Jahre mithilfe einer absurden Pseudoreligion zu einer gehorsamen Fanatikerin erzogen. Ein bewegender Fall, in dem nicht Mord, sondern das Schicksal eines jungen Mädchens im Vordergrund steht.
Darum geht es
Rebecca (Gro Swantje Kohlhof) wird neben der brennenden Leiche eines Mannes gefunden. Sie ist komplett verstört und nicht ansprechbar. Zwar ist das Mädchen bereits 17, aber es wirkt wie ein zerbrechliches Kind. Rebecca kennt noch nicht einmal ihren eigenen Namen. Blum und Perlmann sind zunächst ratlos: Weder die Ermittler noch die Psychologen kommen an das Mädchen heran. Was die Kommissare nach ersten Untersuchungen aber sagen können: Rebecca wurde jahrelang gefangen gehalten.
Nach und nach kommen die Details einer grausamen Tat ans Licht: Der Tote, Olaf Reuter, hat das damals zweijährige Mädchen entführt und sie offenbar auf eine spezielle, pseudoreligiöse Weise erzogen. Dadurch lebt Rebecca nach absurden Regeln. Lediglich Perlmann scheint sie zu trauen: In ihm sieht sie einen neuen "Erzieher". Es entwickelt sich eine emotionale Bindung. Nur langsam gibt das traumatisierte Mädchen Informationen preis, zu tief sitzen die eingebläuten Regeln und Verbote.
Als schließlich Indizien darauf hindeuten, dass sich womöglich ein zweites Kind in den Fängen des toten Entführers befunden hat, gerät das Team vom Bodensee unter Druck. Die Ungewissheit, ob das Mädchen noch lebt, zwingt die Kommissare zur schnellen Handlung. Rebeccas Psyche ist in höchstem Maße geschädigt, jede unachtsame Frage kann ihre kleinen therapeutischen Fortschritte kurzerhand zunichtemachen. Ein unerwartet schmaler Grat zwischen psychologischer Betreuung und polizeilicher Ermittlung.
Das macht diesen "Tatort" sehenswert
Das Drehbuch von Marco Wiersch hat es in sich. Die Geschichte, die sehr an die Fälle Kampusch und Fritzl erinnert, ist nichts für sensible Gemüter. Ein Verbrechen mit derartig psychischem Hintergrund schockiert und bewegt gleichermaßen. Der Diplom-Psychologe Wiersch rückt neben Rebecca aber auch gezielt Kai Perlmann in den Mittelpunkt. Der findet sich in einer ungewollten Rolle wieder: als Mischung aus Polizist und Aushilfspsychologe. Perlmann ist mit etwas konfrontiert, das ihn als Mensch an den Rand seiner emotionalen Kapazität bringt, und das von ihm als Kommissar im gleichen Moment höchste Professionalität abverlangt. Ein mitreißender Konflikt, den der Zuschauer absolut nachvollziehen kann.
Am meisten beeindruckt aber Gro Swantje Kohlhof, die ihre Rolle der Rebecca nicht überzeugender hätte spielen können. Eindringlich, emotional und absolut glaubhaft präsentiert sie die Psyche des missbrauchten Kindes. Ihr abartiges Schicksal rückt alles andere in den Hintergrund. Es wirft aber auch viele Fragen auf, die den Zuschauer über den Krimi hinaus beschäftigen: Kann ein Kind ein solches Trauma überwinden? Wird sie jemals ihre pseudoreligiöse Erziehung hinter sich lassen können? Wird sie irgendwann ein annähernd normales Leben führen können?
Wer bei "Rebecca" auf typische Krimi-Atmosphäre und gnadenlose Spannung gehofft hat, wird hier nicht auf seine Kosten kommen. Dafür zieht dieser "Tatort" den Zuschauer auf seine ganz eigene Weise in den Bann. Der Drang nach Aufklärung ist hier ein ganz besonderer: Der Zuschauer wird sehr schnell ungeduldig. Er steht vor einer Wand, sieht nicht mehr als die Kommissare selber. Lediglich Rebeccas kurze Erinnerungen geben ihm minimale Einsicht. Das Hauptaugenmerk liegt aber dennoch auf Rebecca als Mensch, wie sie sich entwickelt und inwieweit sich ihre therapeutische Betreuung auswirkt. Und das unerwartete Ende dürfte selbst für weniger Überzeugte sehr befriedigend sein.