Urteil: Hartz IV-Leistungen reichen Familien nicht
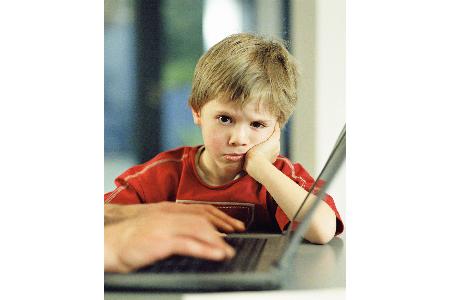
Die Hartz IV-Regelsätze für Familien sind nach Ansicht des Hessischen Landessozialgerichts weder mit der Menschenwürde noch dem Grundgesetz vereinbar. Das Sozialgericht Berlin hält nicht jeden Ein-Euro-Job für zumutbar und das Bundessozialgericht in Kassel ordnet bei Klassenfahrten eine vollständige Kostenübernahme durch die Jobcenter an. Diese und weitere interessante Entscheidungen um die Arbeitsmarktreform haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Die Hartz IV-Regelleistungen decken nicht das soziokulturelle Existenzminimum von Familien und verstoßen damit gegen das Grundgesetz. Das hat das Hessische Landessozialgericht in Darmstadt festgestellt (Az.: L 6 AS 336/07). Ein entsprechendes Verfahren soll nun dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden.
Hartz IV nicht genug für Familie
Geklagt hatte eine Familie aus dem Werra-Meisner-Kreis, die als Bedarfsgemeinschaft Arbeitslosengeld (ALG) II bezieht. Für die Eltern wurde jeweils der Regelsatz in Höhe von 311 Euro bewilligt, für die 1994 geborene Tochter der Satz von 207 Euro. Nach Ansicht der Kläger ist damit ihr minimaler Bedarf nicht gedeckt. Mit ihrem Antrag auf weitere 133 Euro für jedes Elternteil und 89 Euro für die Tochter blieben sie im Verwaltungsverfahren sowie vor dem Sozialgericht vorerst erfolglos.
Nachdem vier Gutachten zur Bedarfsbemessung eingeholt worden waren, urteilten die Darmstädter Richter nun jedoch, dass der besondere Bedarf von Familien mit Kindern durch die Regelleistungen nicht berücksichtigt werde. Für die Begrenzung der Leistung für Kinder auf 60 Prozent des Regelsatzes eines Erwachsenen fehle es an einer hinreichenden Begründung. Nicht ersichtlich sei auch, weshalb 14-jährige Kinder trotz höheren Bedarfs die gleiche Summe erhielten wie Neugeborene.
Mehrbedarf bei Kindern nicht berücksichtigt
Das Bundesverfassungsgericht habe bereits 1998 bei der Prüfung der Steuerfreibeträge den damals geltenden Regelsatz für Kinder beanstandet, weil dieser den außerschulischen Bildungsbedarf nicht berücksichtige. Diese höchstrichterliche Entscheidung sei bei der Hartz IV-Gesetzgebung nicht beachtet worden, kritisierte das Landessozialgericht. Die Regelsätze seien weder mit der Menschenwürde, noch mit dem Gleichheitsgebot und dem sozialen Rechtsstaat vereinbar.
Die am 1. Januar 2005 eingeführte Hartz IV-Reform hat zu einer beispiellosen Klageflut geführt. Verstärkt wurde der Trend durch zahlreiche Verschärfungen, die die Regierung in den zurückliegenden zwei Jahren beschlossen hat. So rechnen Experten damit, dass allein an Deutschlands größtem Sozialgericht in Berlin bis zum Jahresende 21.000 neue Klagen nur zu der Arbeitsmarktreform eingegangen sind. Da davon voraussichtlich 16.000 Hartz IV-Verfahren nicht abgeschlossen werden können, plant die Stadt die Einstellung von 40 weiteren Richtern.
Streitfall eheähnliche Gemeinschaften
Im Zentrum der Klagen stehen Fragen zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen, Größe und Kosten einer Wohnung sowie zur Einstufung als eheähnliche Lebensgemeinschaft. Denn in guten wie in schlechten Zeiten - das gilt bei Hartz IV auch für unverheiratete Paare. Laut Gesetz wird bei ALG II-Empfängern das Einkommen des erwerbstätigen Partners voll angerechnet. Durch diese "eheähnlichen Gemeinschaft" verlieren viele Arbeitslose ihren Anspruch auf Unterstützungsleistungen.
Einkommen neuer Partner wird angerechnet
Wenn arbeitslose Väter oder Mütter also mit ihren Kindern zu einem anderen Partner ziehen, muss dessen Einkommen voll angerechnet werden, unterstrich jetzt noch mal das Bundessozialgericht in Kassel. Das gelte auch bei den Kindern, für die der neue Lebensgefährte eigentlich nicht unterhaltspflichtig ist (Az.: B 14 AS 2/08 R). Einschränkungen machen hier jedoch die Richter vom Landessozialgericht Berlin-Brandenburg in Potsdam. Paare, die seit weniger als einem Jahr zusammenlebten, seien noch keine Bedarfsgemeinschaft im Sinne von Hartz IV (Az.: L5B 1362/05 AS ER).
Im konkreten Fall bezog ein Mann seit fünf Monaten ALG-II und lebte seit dieser Zeit auch mit seiner Partnerin in einer Wohnung. Das Jobcenter rechnete das Gehalt der Frau sofort an und kürzte die Unterstützung. Zu Unrecht, befand das Potsdamer Gericht. Von einer "Verantwortungsgemeinschaft", bei der Paare einander in Notfällen beiständen, könne bei einer so kurzen Beziehungsdauer noch nicht die Rede sein. Das gelte erst recht, wenn ein Paar keine gemeinsamen Kinder habe.
Ein weiterer häufiger Streitpunkt sind Bestimmungen zur Größe und Kosten einer Wohnung. Hartz IV-Empfänger erhalten neben dem ALG II von 347 Euro je Monat auch die Mietkosten für eine Wohnung in "angemessener Größe" erstattet. Was angemessen ist, haben jetzt die Richter des Bundessozialgerichts definiert.
Angemessene Mietwohnung
Demnach bestimmt sich die zulässige Miethöhe nach der Situation auf dem örtlichen Wohnungsmarkt (Az.: B 7b AS 18/06 R). Existiere ein kommunaler Mietspiegel, sei dieser maßgeblich. Andernfalls müssten sich die Behörden ans Rechnen machen. Die von vielen Kommunen praktizierte Anwendung der bundesweit geltenden Wohngeldtabellen - egal ob für das teure München oder ein Dorf in der Provinz - sei im Regelfall nicht zulässig, da diese zu ungenau seien.
Was den Standard der Wohnung anbelangt, so steht ALG II-Beziehern laut Urteilsspruch ein "einfacher und im untersten Segment liegender Ausstattungsgrad" zu. Als Vergleichsmaßstab zieht das Gericht wiederum das Durchschnittsniveau am jeweiligen Wohnort heran. Der Umzug in eine andere Gemeinde oder Stadt komme in der Regel nicht in Betracht.
Angemessene Eigentumswohnung
In einer weiteren Entscheidung hat das Bundessozialgericht Wohnungsgrößen festgelegt, bis zu denen Hartz IV-Empfänger Wohneigentum selbst nutzen dürfen. Dabei sahen die Richter 120 Quadratmeter als Standardgröße für eine vierköpfige Familie (Az.: B 7b AS 2/05 R). Unterhalb dieser Größen gelte die Eigentumswohnung als so genanntes Schonvermögen und müsse von den Sozialbehörden respektiert werden.
Bei größeren Wohnungen halten die Richter einen Umzug in eine kleinere sowie eine Verwertung der Wohnung - sprich Verkauf oder Vermietung - für zumutbar. Für einen Single gelte noch eine 80 Quadratmeter-Eigentumswohnung als angemessen und müsse nicht verkauft werden. Hintergrund: Im Regelfall sei auch bei Singles von einer Mindestzahl von zwei Personen pro Appartement auszugehen. Dabei werde unterstellt, dass auch ein Alleinstehender noch (oder wieder) einen Partner findet, mit dem er zusammenzieht.
Ist eine Wohnung erwiesener Maßen nicht angemessen, können Gemeinden von ihren Hartz IV-Empfängern verlangen, dass diese ihre Wohnungen für Untermieter öffnen, um die Mietkosten zu senken. Das hat das hessische Landessozialgericht in Darmstadt entschieden (Az.: AZ L 7 AS 126/06 ER).
Untermieter oder Umzug
Geklagt hatte ein Arbeitsloser aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg, der in einer 90-Quadratmeter-Wohnung lebte. Seiner Meinung nach sei die geforderte Aufnahme eines Mitbewohners wegen der gemeinsamen Nutzung von Küche und Bad unzumutbar. Doch dieser Auffassung folgten die Richter nicht. Der Arbeitslose müsse sich entweder einen Untermieter oder eine preiswertere Wohnung suchen, hieß es im Urteilsspruch.
Keine Pauschale bei Heizkosten
In einem anderen Punkt konnte der arbeitslose Kläger jedoch einen Teilerfolg erzielen: Bei der Abrechnung der Heizungskosten sei es nicht zulässig, dass der Landkreis nur eine Pauschale (angemessene Wohnfläche mal 0,80 Euro) übernehme, wenn "eine konkrete und nachvollziehbare Berechnung der Heizkosten vorliege", entschied das Gericht. Ausnahmen seien nur möglich, wenn Anhaltspunkte für ein unwirtschaftliches Energieverhalten des Arbeitslosen vorlägen.
Medizinische Grundversorgung
Die medizinische Grundversorgung bei anhaltenden (chronischen) Erkrankungen ist meist sehr kostenintensiv. Eine Übernahme entsprechender Zusatzkosten wurde von der Bundesagentur für Arbeit abgelehnt. Begründung: Das zweite Sozialgesetzbuch enthalte hierfür keine Regelung.
Doch das sahen die Richter am Sozialgericht Lüneburg anders. Da die Regelleistung des ALG II bei monatlichen Mehrausgaben (im konkreten Fall 240 Euro) nicht ausreiche, müssten diese Kosten auch ohne Regelung im Sozialgesetzbuch übernommen werden. Sonst sei auch das verfassungsrechtlich geschützte Existenzminimum nicht mehr gesichert (Az.: S 30 AS 328/05).
Einen so genannten Ein-Euro-Job müssen Langzeitarbeitslose nur annehmen, wenn er sinnvoll ist und zudem eine Vereinbarung mit der Hartz IV-Behörde den Inhalt und Umfang genau regelt. Andernfalls können ALG II-Empfänger die Beschäftigung ablehnen, ohne dass ihnen die Leistungen gekürzt werden dürfe, entschied das Sozialgericht Berlin (Az.: S 37 AS 4801/05 ER).
Nicht jeder Ein-Euro-Job ist zumutbar
Im konkreten Fall hatte sich ein 24-Jähriger über sinnlose Reinigungs- und Büroarbeiten beschwert. Daraufhin hatte ihm das Jobcenter gedroht, sein ALG II zu streichen. Dem widersprach das Gericht: Die Vereinbarung zwischen dem Jobcenter und dem Arbeitslosen habe nur allgemein die Einhaltung der Arbeitszeit und -pflichten festgelegt. Dabei müsse die Behörde vielmehr eindeutig und verbindlich Arbeitsinhalte und exakte Arbeitszeit regeln. Nur so sei garantiert, dass die Beschäftigung dem Sozialgesetzbuch II entspreche und ausschließlich zusätzlich und gemeinnützig sei.
Fahrtkosten bei Ein-Euro-Jobs
Über eine weitere Frage, die vor allem Ein-Euro-Jobber mit längerem Arbeitsweg beschäftigt, urteilte jetzt das Bundessozialgericht in Kassel. Müssen Ein-Euro-Jobbern die Fahrtkosten zur Arbeitsgelegenheit erstattet werden? Nein, meinten die Kassel.r Richter und wiesen die Klage eines Arbeitslosen aus dem Sauerland ab. Dieser hatte es für unzumutbar gehalten, von seinem "Lohn" von gut 120 Euro monatlich auch die 51,90 Euro teure Monatskarte zu bezahlen.
Vager Verdacht reicht nicht für Hausbesuch
Ein vager Verdacht auf falsche Angaben reicht für einen Hausbesuch bei Empfängern von Arbeitslosengeld II nicht aus. Das geht aus einem Beschluss des hessischen Landessozialgerichts hervor (Az.: L 7 AS 1/06 ER). Die Verweigerung eines Besuchs sei folglich kein Grund, Hartz IV-Leistungen zu streichen.
Die Unverletzlichkeit der Wohnung sei ein hohes Gut, begründete das Gericht seine Entscheidung. ALG II-Bezieher müssten nur dann Besuche der Arbeitsagentur oder der Kommune erlauben, wenn berechtigte Zweifel an den Angaben des Betroffenen bestünden und diese Zweifel mit einem Hausbesuch geklärt werden könnten. Im Übrigen sei ein Hausbesuch nicht geeignet, eine mögliche Geschäftstätigkeit nachzuweisen.
Interessant für Eltern, die Hartz IV beziehen: Die Jobcenter müssen die Kosten für Klassenfahrten ihrer Sprösslinge voll übernehmen. Dazu bestehe eine gesetzliche Verpflichtung, die sich eindeutig aus dem Sozialgesetzbuch ergebe, urteilte bereits vor zwei Jahren das Sozialgericht Schleswig in einem Eilbeschluss (Az.: S 6 AS 556/06 ER). Dies wurde in einem aktuellen Urteil jetzt nochmals vom Bundessozialgericht in Kassel unterstrichen.
Kosten für Klassenfahrt nicht begrenzbar
Mit dem Grundsatzurteil gab es einer Berliner Familie Recht. Deren zwei Söhne sollten an Fahrten nach Brandenburg und Florenz teilnehmen. Die Kosten von 285 Euro bzw. 719 Euro wollte das Jobcenter nur teilweise übernehmen. Dazu verwiesen sie auf eine allgemeine Deckelung der Kostenerstattung für Klassenfahrten. Die Grenze hierfür lag in Berlin bei 400 Euro für Auslandsfahrten und 180 Euro für Fahrten ins benachbarte Brandenburg.
Doch eine solche Deckelung ist nach Meinung der Kassel.r Richter nicht mit dem maßgeblichen Sozialgesetzbuch II vereinbar. Vielmehr seien die Kosten "in voller Höhe zu übernehmen", sofern Klassenfahrten den schulrechtlichen Bestimmungen entsprechen. So solle eine Ausgrenzung der Kinder gerade im schulischen Bereich verhindert werden.

