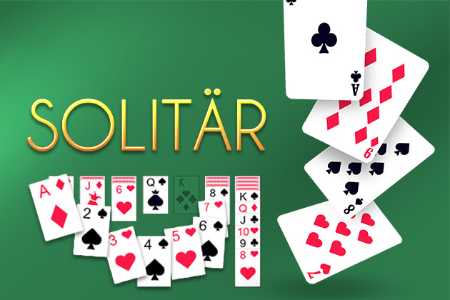Hypochondrie: Was hilft gegen die Angst vor Krankheiten?

Hypochondrie: Die ständige Angst vor Krankheit
Menschen mit Hypochondrie prüfen beständig, ob ihre Gesundheit in Gefahr ist, und vermuten oft das Vorliegen einer schweren Krankheit. "Sie sind überzeugt, dass ihre Gesundheit in großer Gefahr ist", sagt Klaus-Dirk Kampz, Geschäftsführer der My Way Psychiatrischen Klinik in Reichshof-Eckenhagen (NRW). Das Hauptsymptom besteht in einer übermäßigen Beschäftigung mit körperlichen Symptomen, meist ohne tatsächliche medizinische Befunde. Kampz erklärt: "Menschen mit einer hypochondrischen Störung leiden enorm unter der Ungewissheit, da sie keine Erklärung für ihre Symptome finden können."
Der Einfluss auf den Alltag
Das ständige Gefühl von Unsicherheit führt häufig zu zahlreichen Arztbesuchen und Arztwechsel. Betroffene zweifeln regelmäßig an medizinischen Befunden und meiden Situationen, die ihre Angst erhöhen könnten, wie berufliche oder Freizeitaktivitäten. Aufgrund ihrer Angst überwachen sie ständig ihre Körperfunktionen, messen etwa häufig den Puls oder Blutdruck und deuten selbst kleinste Abweichungen als schwere Erkrankungen. Diese zwanghafte Kontrolle beeinträchtigt den Alltag und ist eine verzweifelte Suche nach Sicherheit. Laut Kampz ist die psychische Erkrankung künftig in der ICD-11-Klassifikation der WHO als Zwangsstörung eingestuft.
Die Bedeutung der psychischen Behandlung
Zusätzlich zur Angst vor körperlicher Krankheit haben Betroffene oft Bedenken, ihre Sorgen als psychische Störung zu akzeptieren, verstärkt durch möglicherweise schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem oder Stigmatisierung. Ohne Behandlung drohen zusätzliche psychische Probleme wie Depressionen oder Panikattacken, weshalb Experten, wie die der Schön Klinik Roseneck, zur Psychotherapie raten. Hypochondrie führt zu äußerst real empfundenem Leiden, sodass Betroffene ihre Denk- und Verhaltensmuster nicht leicht ändern können.
Hoffnung durch Therapie
Durch professionelle Unterstützung, meist in Form von Verhaltenstherapie, können Betroffene ihre Ängste erforschen und Bewältigungsstrategien entwickeln, die den Alltag mit weniger Sorgen ermöglichen. Ein entscheidender Schritt, so Kampz, ist die Akzeptanz, dass es "keine absolute Gewissheit für eine gesunde Verfassung gibt, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit".